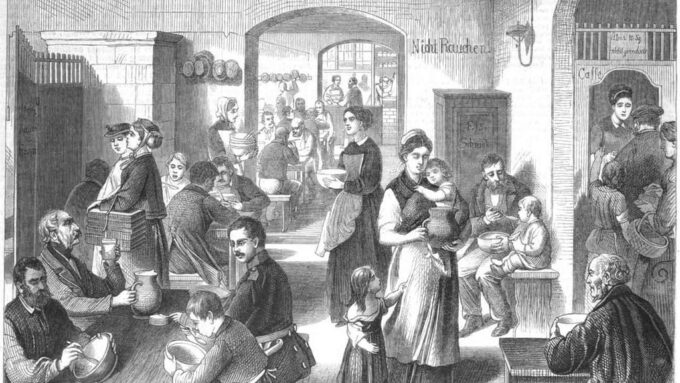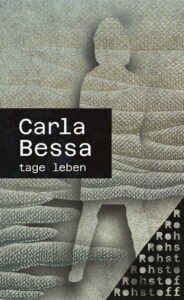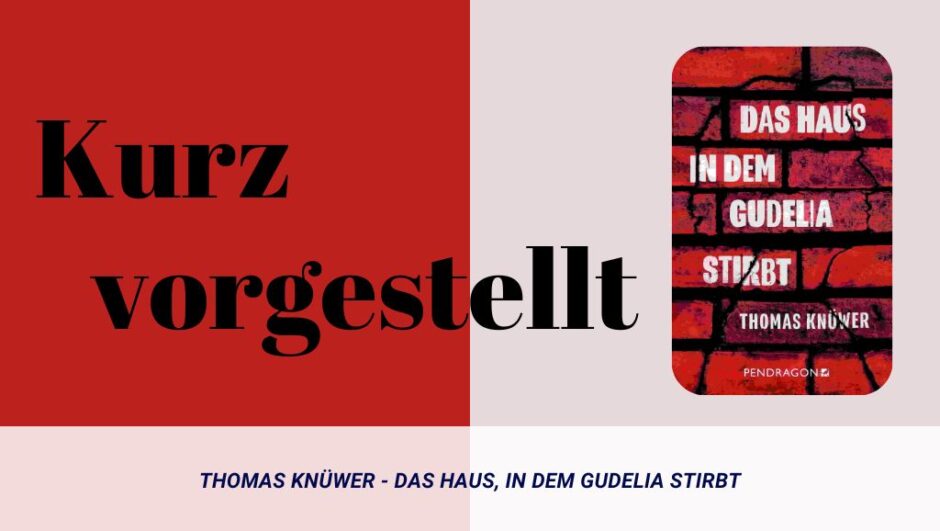Wer war Lina Morgenstern? Noch nie gehört? Da geht es euch so wie mir, bevor ich von Autor Gerhard J. Rekel auf sein Buch Lina Morgenstern. Die Geschichte einer Rebellin aufmerksam gemacht wurde. Nach dessen… Mehr
Carla Bessa – tage leben
tage leben von Carla Bessa trägt keine Genre-Bezeichnung. Es ist ein Text, der formal changiert, auch in der Typografie. Rechtsbündiger und linksbündiger Flattersatz, Mittelachsensatz – der Text gleicht optisch (und manchmal ganz) einem lyrischen Werk. Die Erzählerin Carla Bessa sucht augenscheinlich nach einer Form für das, was sie erzählen will, erzählen muss. Es sind zwei tragische Ereignisse, die in den Juni 2000 zurückführen. Eines davon berührt sie ganz persönlich. Sie verknüpft es mit einem anderen Vorfall, der nur einen Tag früher ebenfalls in Rio de Janeiro stattgefunden hat und setzt beide in Beziehung zueinander.
„zwei tage waren es
zwei leben in zwei tagen
zwei tage
leben waren es“
Man spürt das Ringen um den Text, das sich auch in ungewöhnlicher Zeichensetzung und Textstruktur äußert. Und im anfangs sehr häufigen Wechsel von der Ich-Perspektive in die dritte Person „sie“. Der Text ist zudem konsequent in Kleinschreibung verfasst.
Zwei Gewalttaten im Juni 2000
Es ist der 14. Juni 2000, als die Erzählerin einen Anruf ihres Bruders aus Brasilien erhält. Sie selbst lebt mit ihrem Lebenspartner in Deutschland. Der Anrufer teilt ihr mit, dass der ältere Bruder am Vortag ermordet wurde. Er wurde Opfer eines Raubüberfalls kurz vor der Tür seines Hauses in Niteroi, unweit einer der berüchtigten Favelas. Da er zur Zeit des Überfalls mit seiner Ex-Frau telefonierte, bekam diese Teile der Ermordung quasi live mit. Der Bruder bittet die Erzählerin, nach Brasilien zu kommen und sich um die Mutter zu kümmern.
Noch einen Tag früher „entführte der 21-jährige Sandro do Nascimento einen voll besetzten Bus der Linie 174 in Rio de Janeiro. Gleichzeitig mit der Polizei waren die Medien zur Stelle und übertrugen die tragisch endende Entführung viereinhalb Stunden lang live. Wie sich später herausstellte, war der Entführer ein Überlebender des Candelária Massakers, ein Massenmord, der sich sieben Jahre zuvor an der Candelária Kirche in der Innenstadt von Rio de Janeiro ereignet und ein großes Medienecho hervorgerufen hatte. In einer Nacht waren acht obdachlose Kinder von einem Todesschwadron-Kommando im Schlaf ermordet worden.“ Noch davor wurde Sandros Mutter ermordet. Er war da noch ein Kind. Er war es, der seine tote Mutter fand.
Eine Spirale der Gewalt
Es ist eine Spirale der Gewalt, die wiederum Gewalt hervorruft. Armut, Elend, Hoffnungslosigkeit sind die Ingredienzien. Brasilien hatte um das Jahr 2000 eine der höchsten Mordraten weltweit. Großstädte wie Rio de Janeiro waren davon besonders betroffen. Bandenkriminalität, Entführungen, Aufstände und Polizeigewalt waren omnipräsent. Das Land stand sicherheitspolitisch am Abgrund. Auch wenn die Mordrate bis heute stark gesunken ist, bestehen viele Probleme fort, vor allem eine Gewaltursache: die starke soziale Ungleichheit.
Carla Bessa geht den beiden Gewalttaten nach, versucht sie zu rekonstruieren, sich in die Beteiligten hineinzuversetzen. Zugleich begleitet sie ihre Erzählerin von Deutschland nach Brasilien, zur Familie, ins Zentrum der Trauer. Der Text ist nicht leicht zu lesen. Es dauert eine Weile, bis man sich in die formalen Besonderheiten eingefunden hat. Dann aber entwickelt er einen ganz eigenen Sog und lässt die Leserin tief berührt zurück.
Carla Bessa wurde in Niteroi bei Rio de Janeiro geboren und lebt seit 1991 in Deutschland. tage leben ist ihr erster auf Deutsch verfasster Roman.
Beitragsbild: Favelas in Niteroi by HVL, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
x
Carla Bessa – tage leben
rohstoff Verlag Dezember 2025, 220 Seiten, Broschur, 12,00 €
Lektüre Januar 2026
Lektüre im Januar bedeutet auch 2026 für mich noch ein wenig verweilen im alten Jahr. Die „dringlichsten“ Lektüren und Besprechungen sind erledigt und man kann sich den Büchern widmen, die aus welchen Gründen auch immer erst einmal liegen geblieben sind. Bei mir waren das zum Beispiel die im Sommer angelesenen Debüts für den Franz Tumler Preis (zumindest drei davon). Oder die hochgelobten Romane von Gaea Schoeters und Katharina Köller. Im Lesekreis haben wir das wunderbare Buch von Georgi Gospodinov gelesen und es gab auch Zeit für gute Unterhaltung: Caren Benedikt hat mich erneut mit ihrer Hotel-Saga nach Usedom entführt und Maxim Leo in ein ganz aberwitziges Szenario: wenn das Altern plötzlich abgeschafft ist – aber sich die Menschen daran gar nicht erfreuen können. Und Wolf Haas wirbelt mit seinem Wackelkontakt nur so durch die Buchseiten. Es gab Verzweiflungen und ein sehr berührendes Abschiedsbuch von Julian Barnes, den ich seit langem sehr verehre und der gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Weiterlesen „Lektüre Januar 2026“
Heike Geißler – Verzweiflungen
Verzweiflungen – wer kennt sie nicht? Im ganz Privaten, Persönlichen oder zunehmend aufgrund der Weltlage, der sich stetig zuspitzenden politischen Entwicklungen und Krisen. Heike Geißler hat über diese Verzweiflungen (bewusst im Plural gehalten) ein so kluges wie wütendes wie tröstendes Essay verfasst. Im Oktober 2024 erhielt Heike Geißler dafür den Bayerischen Buchpreis. Und ich muss zugeben, dass ich das feuerrote Büchlein aus der edition suhrkamp sonst vielleicht übersehen hätte. Weiterlesen „Heike Geißler – Verzweiflungen“
Amira Ben Saoud – Schweben
Zukunftsromane, gar Dystopien stehen normalerweise eher selten auf meinen Leselisten. Und heute, wo dystopische Szenarien, die vor einigen Jahren noch völlig fremd erschienen, plötzlich erschreckend nah rücken, mag ich solche Geschichten fast noch weniger lesen. Wie gut, dass die Einladung zur Verleihung des Franz Tumler Preises im letzten Jahr mir Schweben von Amira Ben Saoud in den Lesesessel gespült hat. Weiterlesen „Amira Ben Saoud – Schweben“
Lena Schätte – Das Schwarz an den Händen meines Vaters – Kurz vorgestellt
Einige Kritiker:innen haben Lena Schättes für die Longlist des Deutschen Buchpreises 2025 nominierten Roman als einen Suchtroman bezeichnet. Und tatsächlich gibt es hier eine ganze Ahnenreihe von Abhängigkeiten, in erster Linie vom Alkohol. Der Großvater erfror einst im Schnee, in den er volltrunken gefallen war, der Vater ist schwer alkoholabhängig und wird relativ früh an den Folgen dieser Sucht sterben, der Pfarrer säuft und auch der Freund und die Ich-Erzählerin selbst trinken viel zu viel. Sie alle trinken, um „das Leben auszuhalten“ – eine Forderungen, seine Demütigungen, seine unerfüllten Hoffnungen. Keiner der Betroffenen wird als gewalttätig oder verachtenswert beschrieben. Es ist kein Buch der Abrechnung, der Vorwürfe, der Rache, sondern eher ein Buch der Liebe. Besonders zum Vater. Aber es ist eben auch ein Buch über das Fatale der Sucht und über Co-Abhängigkeit. Weiterlesen „Lena Schätte – Das Schwarz an den Händen meines Vaters – Kurz vorgestellt“
Gael Faye – Jacaranda
Der Jacaranda-Baum, der ein wahres Meer an lavendelblauen Blüten trägt, ist nicht nur Titelgeber für den neuen, mit dem Prix Renaudot ausgezeichneten Roman von Gael Faye, sondern auch ein Dreh- und Angelpunkt des Textes. In seine Krone flüchtet sich das ruandische Mädchen Stella, wenn der Kummer mal wieder zu groß wird, ihre Mutter Eusébie zu abweisend ist oder sie einfach mal ihre Ruhe haben möchte. Als er irgendwann gefällt wird, um modernen Mietwohnungen Platz zu machen, gerät Stella in eine tiefe psychische Krise. Und schließlich ist der Baum auch ein Ort der Erinnerung, des Gedenkens, des Schmerzes – wovon sich nicht nur Eusébie, sondern mit ihr ein Großteil der ruandischen Bevölkerung befreien möchte. Doch von vorne. Weiterlesen „Gael Faye – Jacaranda“
Thomas Knüwer – Das Haus in dem Gudelia stirbt – Kurz vorgestellt
2024 gewann Thomas Knüwer mit seinem Debüt-Kriminalroman Das Haus, in dem Gudelia stirbt den Deutschen Krimipreis national. Ein ganz außergewöhnlicher, überraschender Text – das hat auch die Jury überzeugt.
Es beginnt mit einem Prolog, der schon offenbart, wohin der Roman führt:
„Die alte Frau liegt im Dreck und lächelt. Es ist gerecht, denkt sie. Schuld schwimmt oben. Die Bine kann sie nicht bewegen. Erst hat er das linke, dann das rechte mit dem Spaten zertrümmert. Jesus Maria, hat sie geschrien.“
Die alte Frau, Gudelia Krol, übernimmt fortan die Rolle der Ich-Erzählerin. Und das auf drei Zeitebenen. Weiterlesen „Thomas Knüwer – Das Haus in dem Gudelia stirbt – Kurz vorgestellt“
Anna Maschik – Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten
Autofiktionale Familiengeschichten, die ihren Schwerpunkt auf Frauenfiguren legen, gibt es zurzeit zuhauf. Dafür, sich auch in diesem überrepräsentierten Genre umzuschauen, sprechen immer wieder die tollen Entdeckungen, die man als Leserin hier machen kann. Anna Maschik beispielsweise hat mit ihrem Debütroman Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten einen ganz großartigen Text zum Thema verfasst. Weiterlesen „Anna Maschik – Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten“
Sarah Jäger – Das Feuer vergessen wir nicht – Kurz vorgestellt
Frisch mit dem Jugendliteraturpreis für ihren vorigen Roman „Und die Welt, sie fliegt hoch“ (zusammen mit Illustratorin Sarah Maus) ausgezeichnet, legt Sarah Jäger mit Das Feuer vergessen wir nicht bereits ein neues Buch vor. Auf LiteraturReich ist die sogenannte Jugendliteratur eher die Ausnahme. Eine Ausnahme, die ich immer wieder gerne mache, denn Sarah Jäger besitz eine ganz großartige, authentische Sprache, schreibt wunderbare Dialoge schreibt und erzählt in jedem Buch eine sehr besondere Geschichte. Es sind Bücher, die vor Problemen und Konflikten nicht die Augen verschließen, und die dennoch auf eine stille Art glücklich machen. Weiterlesen „Sarah Jäger – Das Feuer vergessen wir nicht – Kurz vorgestellt“
Joana Osman – Frieden. Eine reale Utopie
Wir leben in einer verstörenden Gegenwart. Spaltung, Dehumanisierung, Konfrontation – noch vor wenigen Jahren hätte man nicht gedacht, dass sich die Gesellschaft weltweit von diesen Vokabeln beherrschen lassen würde. Selbst in den tiefsten Phasen des Kalten Kriegs galten Werte wie Frieden, Toleranz, Solidarität zumindest in der Theorie als etwas, das es anzustreben galt. Mittlerweile spricht man schon wieder von Kriegstüchtigkeit, die man erreichen müsse, wird wieder die Wehrpflicht gefordert und scheint es neben der Abschreckung keinerlei Alternative für die Friedenserhaltung zu geben. Ja, die Weltlage hat sich erschreckend schnell geändert. Und mit ihr auch die Narrative. Sie sind unglaublich negativ geworden, beängstigend, fatalistisch. Wir befinden uns in einer „Polykrise“. Weiterlesen „Joana Osman – Frieden. Eine reale Utopie“