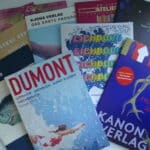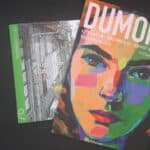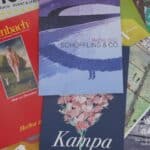Nun stehe ich also hier. Unter dem kunstvoll geschwungenen Band von „Arbeit macht frei“. Schaue entlang der Schienen auf das ikonisch gewordene Torhaus von Birkenau. Im Gepäck habe ich den Roman „Kaltes Krematorium, Bericht aus dem Land namens Auschwitz“ von József Debreczeni und geschätzt vierzig Jahre des Interesses, des Entsetzens, des ungläubigen Staunens darüber, zu welcher Grausamkeit der Mensch doch fähig ist. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag in der Schule erinnern, als im Fach Geschichte eine Filmvorführung anstand. Filmvorführungen waren immer gut, waren Ausnahmen vom Frontalunterricht und außerdem bestanden immer gute Chancen, dass die Videorekorder-TV-Anbindung mal wieder nicht zu den Kernkompetenzen der Lehrkraft gehörte und die Stunde allein mit technischen Problemlösungen vorbeiging.
#gegendasvergessen
An diesem Tag war es anders. Alle 9./10. Klassen sahen diesen einen Film. Wir wurden mit ernst-empathischem Ton auf den Inhalt eingestimmt und uns wurde überraschenderweise gesagt, wir könnten den Raum jederzeit verlassen, wenn es uns zu viel würde. Es war ein Lehrfilm über Auschwitz. Es war die Zeit noch vor den großen Filmen wie „Shoah“ von Claude Lanzman oder „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg. Die Serie „Holocaust“ lief zwar bereits 1979, aber gut versteckt in den dritten Programmen. Anne Frank, Judith Kerr und ähnliches hatte ich zwar gelesen, aber das Originalfilmmaterial von der Befreiung des Konzentrationslagers, der Blick in die Augen der Überlebenden, die Leichenberge – das war für mich/uns ein zutiefst prägendes Moment.
Seitdem ist viel Zeit vergangen. Unzählige wissenschaftliche und literarische Texte und Filmbeiträge zur Shoah, zum Nationalsozialismus und zu den Konzentrationslagern, einige Seminare während eines begonnenen (und leider nicht abgeschlossenen) Geschichtsstudiums später stehe ich immer noch fassungs- und angesichts der Entwicklungen weltweit auch ein wenig ratlos hier in Oświęcim. Der Weg vom modernen Bahnhof führt durch ein wenig ansprechendes Wohngebiet hinaus aus der Stadt. Es weht ein eisiger Wind, Menschenmengen wärmen sich noch ein wenig in der sterilen Groß-Cafeteria, bevor man mit einem Nationalitäten-Schildchen versehen auf die Führung über das riesige Gelände wartet. 3,5 Stunden wird uns Natalia kompetent führen, immer wieder von nachfolgenden Gruppen gedrängt, ihre sachkundigen und bewegenden Ausführungen abzukürzen.
Eine Führung durch das Grauen von Auschwitz
Zunächst geht es durch einen Betontunnel, in dem die Namen ermordeter Gefangener vom Tonband erschallen, leise, eindringlich. Es ist Frühling, trotz der Kälte, die Bäume stehen in Blüte, die Sonne strahlt – die Backsteinbauten sehen von fern fast ein wenig idyllisch aus. Ein Schild „Halt!“, eine Schranke, ein Totenkopf, die typischen Wachtürme – die Frühlingsidylle verschwindet sehr bald. Auschwitz war als Verkehrsknotenpunkt ein idealer Sammelpunkt für die NS-Vernichtungsmaschinerie. Bald gab es 50 Nebenlager. Von den ca. 1,1 Millionen Opfern wurden 865.000 direkt nach der Ankunft im Lager ermordet. Auschwitz steht wie nichts anderes für die Grauen und Schrecken der NS-Ideologie. Auch wenn es darüber hinaus natürlich noch Treblinka, Majdanek, Sobibor und Belzec gab.
Das Lagermuseum zeigt 800.000 Schuhe, unzählige Gepäckstücke, Tonnen von abrasiertem Haar, Brillen – und in einer Baracke Fotos, die einigen Opfern endlich auch Gesichter geben. Die Arrestzellen, Hunger- und Steharrestzellen – und dann die Gaskammern und Krematorien. Hinter einer Blütenhecke nur wenig versteckt die Villa von Lagerleiter Rudolf Höß, in der er mit Frau und fünf Kindern in unmittelbarer Nachbarschaft lebte. Auch wenn man schon viel über diesen Wahnsinn gelesen hat, verschlägt es doch den Atem. Das Land namens Auschwitz.
 József Debreczenis Zeugnis
József Debreczenis Zeugnis
József Debreczeni lebte darin von April 1944 bis zur Befreiung. Als ungarischer Jude wurde er aus der Batschka in Serbien deportiert. Im eigentlichen Lager Auschwitz verbrachte er nur relativ kurze Zeit, wurde von dort in verschiedene Außenlager des Konzentrationslagers Groß-Rosen verschleppt. Auch dies ein Ort im Land namens Auschwitz. Bereits 1950 wurde das Buch in Ungarn veröffentlicht, fand aber in anderen Ländern keine Verlage. Erst in diesem Jahr, 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wurde es in verschiedene Sprachen übersetzt, zum Glück auch auf Deutsch.
In sehr eindrücklichen Bildern und im Stil einer erzählenden Reportage berichtet József Debreczeni von seiner Ankunft in Auschwitz, den Selektionen, seiner Verschiebung nach Groß-Rosen, die entsetzlichen Zustände auch dort. Hier war Vernichtung durch Arbeit das Programm. Besonders erschütternd sind die genauen Beschreibungen der fortschreitenden Entmenschlichung der Häftlinge. Ein perfides System, das es nicht nur dem Lagerpersonal „erleichterte“ Grausamkeiten zu begehen, die man sich kaum vorstellen kann, sondern auch jegliche Solidarität zwischen den Insassen weitgehend zerstörte. Mit teuflischer Raffinesse erschufen die Deutschen eine komplizierte Lagerhierarchie und unterstellten die direkten Arbeiten und Kontrollmechanismen, Verteilungs- und Bestrafungsprozesse weitgehend ausgewählten Häftlingen. Daraus entstand das gefürchtete Kapo-System, eine erzwungene, aber erschreckend gut funktionierende Binnenmachthierarchie.
„Die Nazis erschufen in ihren Todeslagern mit methodischem Erfindungsreichtum eine komplizierte Hierarchie der Parias. Die Deutschen selbst blieben innerhalb des Stacheldrahts meist unsichtbar. Aufgaben wie die Verteilung der Nahrung, das Aufrechterhalten der Disziplin, das unmittelbare Beaufsichtigen der Arbeiten, das Ausüben des direkten Terrors, kurz, die Exekutivmacht übertrugen sie einigen Treibern, die sie unter den Deportierten beliebig ernannten. Dieses System war in psychologischer Hinsicht zweifellos mehr als durchdacht.“
Kaltes Krematorium
Als József Debreczeni völlig entkräftet und fast tot ins sogenannte Sterbelager Dörnhau, auch „Kaltes Krematorium“ genannt, verlegt wird, scheint er die fast bevorstehende Ankunft der Roten Armee nicht mehr zu erleben. Doch er überlebt. Und schreibt dieses wichtige Buch mit seinen klaren, genauen Beobachtungen, treffenden Bildern und tiefen psychologischen Analysen. Besonders die Beschreibungen der perfide aufgezwungenen Machtstrukturen und -hierarchien auch unter den Häftlingen und die Mechanismen zur Entmenschlichung sind eindringlich und schonungslos. Auschwitz war nur ein Ort aus dem großen Land des Grauens, das Nazideutschland in weiten Teilen Europas errichtet hatte, dem Land namens Auschwitz.
„„Auschwitz selbst ist voll, die Neuen bleiben nicht hier. Aber das ist egal. In den Außenlagern ist es überall gleich.“ „Was ist ein Außenlager?“ Er zeigt um sich. „Das hier ist ein ganzes Land.“ (…) Auschwitz selbst ist nur das Zentrum. Die Hauptstadt.““
 Zeugnis ablegen
Zeugnis ablegen
Der Gang über das Gelände des Stammlagers Auschwitz und des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau dauerte 3,5 Stunden und wir hätten noch doppelt so lange schauen können. Zeit, die es vielleicht gebraucht hätte, das Grauen des Ortes wirklich spüren zu können. Das, was man sieht mit dem, was man weiß und gelesen hat, verbinden zu können. Das ging leider nur ansatzweise. Umso dringender benötigt es solche Texte wie Kaltes Krematorium von József Debreczeni. Lebende Stimmen gibt es kaum noch. Und ohne diese eindrücklichen Worte werden auch Gedenkorte wie Auschwitz für manche Besucher:innen nur ausgefallenen Motive für Instagram, Hintergründe für Selfies oder murrend hingenommene Ausflugsorte bleiben. Mir war es fast unerträglich, in den berühmten Schlafbaracken zu stehen, in den Gaskammern, vor den Verbrennungsofen. Das Grauen wurde vermittelt durch die Lebenszeugnisse von Primo Levi, Imre Kertész, Seweryna Szmaglewska und jetzt József Debreczeni, deren Texte mich dorthin begleiteten. #gegendasvergessen
Die Fotos entstanden bei meinem Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im April 2025.
.___________________________________________________________________________________
József Debreczeni – Kaltes Krematorium
Bericht aus dem Land namens Auschwitz | Mit einem Nachwort von Carolin Emcke
Übersetzt von: Timea Tankó
S.Fischer November 2024, gebunden, 272 Seiten, € 25,00