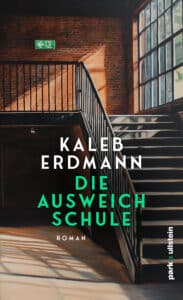Wie schreibt man über eine Katastrophe, ein Unglück, ein schreckliches Ereignis, das unsägliches Leid hervorgerufen hat, ohne voyeuristisch zu sein, sich dieses Ereignisses nur zu bedienen? Und wer darf darüber schreiben? Nur Betroffene? Und wie betroffen muss man sein, um es zu dürfen, es zu können? Fragen, die sich der Autor Kaleb Erdmann in seinem zweiten Roman Die Ausweichschule stellt. Er, der selbst am 26. April 2002 als Schüler des Gutenberg Gymnasiums in Erfurt Zeuge des Anschlags eines Ex-Schülers war, der elf Lehrern, einer Referendarin, einer Sekretärin, zwei Schülern und einem Polizeibeamten das Leben nahm und die Stadtgesellschaft Erfurts und ganz Deutschland tief und nachhaltig erschütterte.
Kaleb Erdmann war damals 11 Jahre alt, Schüler der 5. Klasse. Der fünften Klasse, in die der Attentäter schwerbewaffnet kurz hineinsah, ohne zu schießen. Die Schüler waren allein, warteten auf die Pause, waren von der Tat also nur indirekt betroffen. Aber was heißt indirekt? Die Biologielehrerin lag blutüberströmt und tot im Flur, Schüsse und Schreie waren zu hören, die Schule wurde evakuiert und war lange für den Schulbetrieb gesperrt. Der Unterricht wurde auf eine Ausweichschule verlegt. Auch wenn es damals noch kein Konzept für solche Situationen gab, wurden die Schüler lange Zeit in psychologischen Stunden betreut.
Wie darüber erzählen?
Vielleicht weil der Ich-Erzähler in Die Ausweichschule – die ein Roman ist und kein Augenzeugenbericht des Autors Kaleb Erdmann – damals so jung war, vielleicht weil er „nur“ „indirekt betroffen“ war, konnte er die Ereignisse lange Zeit verdrängen. Eine Therapie bei der Psychologin Frau Czerny half ihm dabei. Ihn quält allerdings häufig ein unnormal gesteigerter Harndrang. Zeichen eines verdrängten Traumas, einer Angststörung? Als ein Dramatiker mit ihm in Kontakt tritt, weil er ein Bühnenstück über die damaligen Ereignissen schreiben will, kommen beim Erzähler nicht nur Erinnerungen hoch, sondern auch der Wunsch, diese literarisch zu verarbeiten.
Aber wie soll er mit dem Stoff umgehen, wie ihn bearbeiten, damit kein Voyeurismus entsteht? Kaleb Erdmann und damit sein Protagonist wählt die Form des Meta-Romans, in die er seine Skrupel, die eigene Ratlosigkeit mit einfließen lässt. Er stellt sich die Frage, wieviel Recherche notwendig ist, wieviel subjektive Erinnerung zulässig, wieviel „Bauchgefühl“. Natürlich studiert er die einschlägigen Akten, beispielsweise den Gasser-Bericht, in dem eine Kommission unter dem Thüringer Justizstaatssekretär Karl Heinz Gasser die Ereignisse offiziell untersuchte.
Auch mit dem von der Öffentlichkeit eher ablehnend rezipierten Roman von Ines Geipel („Für heute reicht’s“, 2004) setzt er sich auseinander. Und mit dem Werk von Emmanuel Carrère, der sich in seinen Büchern mit ähnlichen Attentaten und Kriminalfällen auseinandergesetzt hat. („Der Widersacher“, 2018, als „Amok“ bereits 2001 veröffentlicht, über den Amoklauf eines Familienvaters oder V13 (2023) über die Terroranschläge in Paris). Auch allgemeinere Texte über Gewalt, etwa von Herta Müller und Leila Slimani finden Erwähnung.
Humor und Selbstironie
Die Reise ins eigene Innere beginnt allerdings mit viel Selbstironie und verliert diesen speziellen Humor trotz des ernsten Themas auch im Verlauf des Romans nie ganz. Ein Gespräch mit dem Lektor Mertens, der offensichtlich ein Fan des Autors Joachim Meyerhoff ist, ganz sicher aber einer des leicht verkäuflichen Textes, ist wirklich sehr lustig. Daran schließt sich eine Szene über den Kauf von Wasserflaschen für ganz spezielle Bedürfnisse an. Auch witzig. Aber der Autor behandelt sein Thema trotzdem mit dem nötigen Ernst, der nötigen Sorgfalt und dem nötigen Fingerspitzengefühl.
Er spricht mit einem früheren Schulfreund, oft mit seiner Partnerin Hatice, nähert sich den Ereignissen und seinem damaligen, 11-jährigen Ich tastend, vorsichtig, auch zweifelnd. Zieht beispielsweise die wechselnde Wahrnehmung des Geschichtslehrers Rainer Heise, der den Attentäter mit der Bemerkung „Sieh mir in die Augen“ gestellt haben soll – erst Held, dann durchaus umstritten, weil er dem Täter die Waffe gelassen hat – heran, um auch mit der Zeit sich verändernde Sichtweisen zu illustrieren. Heute, fast 25 Jahre nach der Tat, haben Erzähler und Autor mehr Distanz. Sind Begriffe wie Posttraumatische Belastungsstörung, Mental Health etc. viel tiefer verankert als damals. Letztendlich thematisiert Die Ausweichschule selbst ein langjähriges Ausweichen vor der Tat.
Beitrag zur Debatte
Dem Erzähler ist dies vielleicht leichter gelungen als anderen. Seine Erfurter-Episode war nur eine kurze. Die Familie stammt aus dem Ruhrgebiet, war erst vor Kürzerem aus Bayreuth nach Erfurt gezogen und verließ auch nicht lange nach der Tat der Stadt. Der Autor hat im Laufe der Recherche die alten Orte wieder aufgesucht. Er will mit seinem Text einen Beitrag zur Debatte liefern, keine alten Wunden aufreißen, wie das vielleicht Ines Geipel mit ihrem nur zwei Jahre nach der Tat veröffentlichten Buch tat. Er geht behutsam vor, nicht chronologisch, eher episodenhaft, die Ereignisse wie sich selbst und seine Umgebung befragend. Ich finde, das ist ihm ausgesprochen gut gelungen und freue mich, dass der Roman die Shortlist zum Deutschen Buchpreis erreicht hat.
Beitragsbild: via Lukas Götz, CC BY-SA 3.0 und Christoph Hoffmann, CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons
x
Kaleb Erdmann – Die Ausweichschule
park x ullstein Juli 2025, Hardcover, 304 Seiten, 22,00 €